Warum der Verbrenner tot ist!
- Dirk Neubauer

- 20. Sept. 2025
- 12 Min. Lesezeit
Seit Jahren werden eAutos bekämpft, gehasst, kaputtgeschrieben. Und seit ebenso langer Zeit sind sie dem Rest der Mobilität um Längen überlegen. Und während der Rest der Welt längst entschieden hat, China uns den Rang in Sachen Automobilkunst abläuft, debattieren wir hier noch immer Technologieoffenheit. Die folgende Recherche zeigt eindrucksvoll, dass diese Debatte nichts weiter ist, als ein zielloses Lobbygeplänkel zum Schutz der heimischen Industrie der Branche. Die aber wäre gut beraten, endlich gute eMobile zu bauen. Statt Politik als Bremse nutzen zu wollen. Für etwas, das man nicht aufhalten kann.

Der globale Wandel hin zu einer kohlenstoffärmeren Zukunft hat den Verkehrssektor in den Fokus gerückt. Angesichts der Dringlichkeit der Klimaziele und der zunehmend strengen Emissionsvorschriften steht die Automobilindustrie vor der entscheidenden Frage nach der Wahl des effizientesten und nachhaltigsten Antriebs. Diese Herausforderung betrifft nicht nur Hersteller und politische Entscheidungsträger, sondern auch die Verbraucher. Eine fundierte Bewertung erfordert eine ganzheitliche Betrachtung, die über die reine Leistung des Motors hinausgeht.
Definition der Analysemethodik: „Well-to-Wheel“ und Lebenszyklusanalyse (LCA)
Um die wahre Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Antriebs zu bewerten, genügt es nicht, die direkten Emissionen eines fahrenden Fahrzeugs zu betrachten. Eine umfassende Analyse muss die gesamte Wertschöpfungskette der Energiebereitstellung berücksichtigen.
Well-to-Wheel (WtW): Dieser Ansatz (von der Quelle bis zum Rad) analysiert die Umweltauswirkungen und Treibhausgasemissionen eines Fahrzeugs über seinen gesamten Lebenszyklus. Er schließt alle Phasen von der Rohstoffgewinnung bis zur Nutzung der Energie am Fahrzeugrad ein.1 Dies umfasst sowohl die direkten Emissionen während der Fahrt (Tank-to-Wheel) als auch die indirekten Emissionen, die bei der Produktion, dem Transport und der Verteilung des Kraftstoffs oder der Energie entstehen (Well-to-Tank).1
Tank-to-Wheel (TtW): Im Gegensatz dazu beschränkt sich die TtW-Betrachtung auf die Effizienz des Motors selbst, also die Umwandlung der im Tank oder Akku gespeicherten Energie in Bewegung.2
Lebenszyklusanalyse (LCA): Die umfassendste Methode ist die LCA. Sie erweitert den WtW-Ansatz um die Emissionen aus der Fahrzeugherstellung und dem Recycling, um eine vollständige Umweltbilanz zu erstellen.3
Überblick über die verglichenen Antriebsarten
Die vorliegende Analyse vergleicht vier primäre Antriebsarten: den klassischen Verbrennungsmotor (ICE), das batterieelektrische Fahrzeug (BEV), das Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug (FCEV) und Hybridantriebe (HEV/PHEV).
Grundlagen: Von der Primärenergie bis zur Bewegung
Die Effizienz eines Antriebs wird durch eine Kaskade von Energieumwandlungsverlusten bestimmt. Jede Umwandlung, von der Primärenergiequelle bis zur tatsächlichen Bewegung des Fahrzeugs, führt zu Verlusten, meist in Form von Abwärme. Das System, das die geringsten Verluste über die gesamte Kette aufweist, ist das effizienteste. Die nachstehende Analyse zeigt, dass die Effizienzunterschiede zwischen den Antriebstechnologien nicht marginal, sondern von grundlegender Natur sind.
Der batterieelektrische Antrieb (BEV)
Der batterieelektrische Antrieb gilt als Effizienz-Champion. Sein Wirkungsgrad ist

im Vergleich zu anderen Technologien unübertroffen. Der Elektromotor selbst wandelt die zugeführte Energie extrem effizient in Bewegung um, mit einem Wirkungsgrad von über 80 %.6 Einige Studien geben sogar Werte von etwa 95 % an 8, wobei technische Spezifikationen von Industriemotoren Effizienzklassen wie IE4 mit Wirkungsgraden von 97 % erreichen.9 Diese hohe Effizienz resultiert daraus, dass Elektromotoren ihre gesamte Energie nahezu ohne nennenswerte Abwärmeverluste direkt in die mechanische Drehung der Räder umsetzen.
Selbst bei Berücksichtigung der Verluste in der vorgelagerten Kette – wie bei der Stromerzeugung, dem Transport und dem Laden der Batterie – bleibt der BEV-Antrieb deutlich überlegen. Im Well-to-Wheel-Vergleich erreicht ein BEV einen Gesamtwirkungsgrad von 64 %.6 Dies bedeutet, dass von der ursprünglich erzeugten Energie am Windrad oder im Kraftwerk 64 % am Rad des Fahrzeugs ankommen, um dieses fortzubewegen.
Der Verbrennungsmotor (ICE)
Der Verbrennungsmotor ist im Effizienzvergleich der Verlierer. Im alltäglichen Fahrbetrieb liegt der Wirkungsgrad eines Benzinmotors bei nur etwa 20 %.6 Mehr als drei Viertel der im Kraftstoff enthaltenen chemischen Energie werden nicht für den Antrieb genutzt, sondern gehen als Abwärme verloren.6 Im Teillastbereich, wie er häufig im Stadtverkehr vorkommt, sinkt die Effizienz sogar auf 25 % oder noch weniger.8 Betrachtet man die gesamte Kette von der Rohölgewinnung bis zur Verbrennung im Motor, liegt der Well-to-Wheel-Wirkungsgrad eines Benziners bei nur 20 %.6 Dies entspricht einem Gesamtverlust von 80 %.6
Der Wasserstoff-Brennstoffzellen-Antrieb (FCEV)
Der Wasserstoffantrieb ist systemisch bedingt ineffizienter als der direkte Elektroantrieb, da er mehrere energieintensive Umwandlungsschritte erfordert. Zunächst muss elektrischer Strom genutzt werden, um Wasser per Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Der Wirkungsgrad dieses Elektrolyseprozesses liegt bei 60 % bis 70 %.11 Im Fahrzeug wird der Wasserstoff dann in einer Brennstoffzelle wieder in elektrische Energie umgewandelt, was mit einem Wirkungsgrad von etwa 60 % geschieht.11 Die resultierende elektrische Energie treibt einen Elektromotor an.
Diese Kaskade von Umwandlungsverlusten führt zu einem deutlich niedrigeren Gesamtwirkungsgrad. In der WtW-Betrachtung erreicht ein FCEV nur einen Wirkungsgrad von etwa 27 %.6 Die technologische Herausforderung liegt also weniger in der Brennstoffzelle selbst als in der grundlegend ineffizienten vorgelagerten Produktion, Speicherung und dem Transport des Wasserstoffs.13
Die Komplexität von Hybrid-Systemen (HEV/PHEV)
Hybridfahrzeuge versuchen, die Ineffizienzen des Verbrennungsmotors zu kompensieren, indem sie ihn mit einem Elektromotor kombinieren. Die Effizienz eines Hybrids ist stark vom Nutzungsprofil abhängig.14 Im Stadtverkehr, wo viel gestoppt und angefahren wird, können die Vorteile des elektrischen Antriebs genutzt werden, wodurch der Wirkungsgrad auf bis zu 30 % steigen kann.15 Auf längeren Autobahnfahrten dominiert jedoch der Verbrennungsmotor, was die Gesamteffizienz reduziert.14 Neuere Forschungen zeigen, dass der Wirkungsgrad von Ottomotoren in Hybridantrieben auf 42 % und mit dem Einsatz von E-Fuels sogar auf 46 % gesteigert werden kann.17
Ein entscheidender Faktor ist das Nutzerverhalten bei Plug-in-Hybriden. Studien haben gezeigt, dass die hohe theoretische Effizienz von PHEVs nur dann erreicht wird, wenn die Batterie regelmäßig geladen wird.18 In der Praxis werden diese Fahrzeuge jedoch häufig nur mit dem Verbrennungsmotor und ohne regelmäßige elektrische Aufladung betrieben, was ihre Umweltbilanz drastisch verschlechtert.16
Antriebsart | TtW-Wirkungsgrad (ca.) | WtW-Wirkungsgrad (ca.) | WtW-Gesamtverluste (ca.) |
Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) | 80 - 95 % 6 | 64 % 7 | 36 % 6 |
Verbrennungsmotor (ICE) | 20 % 6 | 20 % 6 | 80 % 6 |
Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV) | 60 % | 27 % 7 | 73 % 6 |
Hybridantrieb (HEV/PHEV) | bis zu 42 % (Ottomotor) 17 | bis zu 30 % 15 | 70 % |
Der Energiebedarf: Eine quantitative Analyse pro 100 Kilometer
Die Betrachtung der Effizienz in Prozentwerten wird durch die Analyse des konkreten Energiebedarfs pro 100 Kilometer Fahrtstrecke greifbarer. Dieser Vergleich macht deutlich, wie viel Primärenergie erforderlich ist, um ein Fahrzeug anzutreiben.
Direkter Stromverbrauch: Effiziente Nutzung im BEV
Ein durchschnittliches batterieelektrisches Fahrzeug (BEV) verbraucht für eine Strecke von 100 Kilometern etwa 15 bis 19 kWh elektrischer Energie, wobei Ladeverluste bereits mitberücksichtigt sind.5 Dieser relativ geringe Energiebedarf ist ein direktes Resultat des hohen Systemwirkungsgrades.
Der hohe Energieeinsatz für die Wasserstoffproduktion
Ein Wasserstoff-Brennstoffzellen-Fahrzeug (FCEV) benötigt im Durchschnitt etwa 1 Kilogramm Wasserstoff, um 100 Kilometer zurückzulegen.19 Die Herstellung dieses einen Kilogramms Wasserstoff durch Elektrolyse erfordert jedoch eine erhebliche Menge an elektrischem Strom. Die benötigte Energie liegt zwischen 40 und 80 kWh pro Kilogramm.20 Schließt man die Verluste aus Transport, Komprimierung und Speicherung mit ein, kann der Energiebedarf auf bis zu 65 kWh pro Kilogramm ansteigen.19 Dies bedeutet, dass für 100 Kilometer Fahrt mit einem FCEV letztlich 40 bis 65 kWh elektrischer Energie aufgewendet werden müssen. Der hohe Energiebedarf in der vorgelagerten Kette führt zu einem hohen Preis: Ein Kilogramm Wasserstoff kostet in Deutschland an öffentlichen Tankstellen 9,50 €.20
E-Fuels: Die energieintensivste Alternative
Die Produktion von E-Fuels, auch als Power-to-Fuel-Prozess bezeichnet, ist außerordentlich energieintensiv. Die Herstellung von einem Liter synthetischem Diesel benötigt etwa 27 kWh elektrischer Energie.21 Bei einem angenommenen Verbrauch von 6 Litern pro 100 Kilometer, wie er bei einem Diesel-Pkw üblich ist, werden für dieselbe Strecke 160 bis 170 kWh Strom benötigt.21 Dieser immense Energiebedarf führt zu einer grundlegenden Ineffizienz: Die Energie, mit der ein konventionelles Auto mit E-Fuels 100 Kilometer weit fährt (ca. 165 kWh), könnte ein Elektroauto 800 bis 1000 Kilometer weit bewegen.21 Mehrere Quellen bestätigen, dass ein E-Fuel-Fahrzeug drei- bis fünfmal mehr Strom für dieselbe Strecke benötigt als ein Elektroauto.22 Mit Transport- und Lagerverlusten kann sich der Bedarf sogar auf rund 150 kWh pro 100 Kilometer erhöhen.19 Der hohe Energieeinsatz spiegelt sich auch in den Kosten wider, die in Pilotanlagen bei etwa 8,00 € pro Liter liegen.19
Vergleichende Zusammenfassung der Energieeffizienz
Der direkte Vergleich des Energiebedarfs pro 100 Kilometer verdeutlicht die fundamentalen Unterschiede:
BEV: 15 bis 19 kWh/100 km
FCEV: 40 bis 65 kWh/100 km
E-Fuels: 150 bis 170 kWh/100 km
Diese quantitative Analyse zeigt, dass die immensen Umwandlungsverluste bei der Wasserstoff- und E-Fuel-Herstellung bedeuten, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in diesen Szenarien ein Vielfaches der Kapazität erfordern würde, die für die direkte Elektrifizierung des Pkw-Sektors benötigt wird.21 Der hohe Energiebedarf führt zwangsläufig zu höheren Kosten, was Wasserstoff und E-Fuels für den Massenmarkt von Pkw unattraktiv macht.
Die CO₂-Bilanz:
Eine Lebenszyklusanalyse (LCA) im Detail
Die Effizienz eines Antriebs korreliert eng mit seiner Klimabilanz. Eine umfassende Bewertung muss jedoch die Emissionen aus der Fahrzeugherstellung und der Nutzung über die gesamte Lebensdauer betrachten.
Der „CO₂-Rucksack“: Emissionen aus der Fahrzeugherstellung
Die Produktion eines Fahrzeugs erzeugt von vornherein Emissionen, die als "CO₂-Rucksack" bezeichnet werden. Bei einem batterieelektrischen Fahrzeug ist dieser Rucksack aufgrund der energieintensiven Batterieherstellung zunächst größer als bei einem Verbrenner.3 Ein Mittelklassewagen mit Verbrennungsmotor hat einen Rucksack von bis zu 8 Tonnen Kohlenstoffdioxid (
CO2), während ein vergleichbares BEV bis zu 11 Tonnen CO₂ aufweisen kann.4
Die Emissionen bei der Batterieproduktion hängen stark vom Herstellungsort und dem dortigen Strommix ab. Neuere Daten aus dem Jahr 2021 zeigen Werte von 34 bis 77 Kilogramm CO₂-Äquivalente (CO2eq) pro kWh Batteriekapazität.3 Eine Studie der Unternehmensberatung P3 berechnet den aktuellen Ausstoß auf rund 55 Kilogramm
CO2eq/kWh.24 Der Einsatz von kohlenstoffarmem Strom (z. B. aus Kernenergie in Frankreich) kann die Emissionen deutlich reduzieren, während Batterien aus Ländern mit hohem Kohlestromanteil (z. B. China) einen größeren Rucksack aufweisen.25 Das größte Potenzial zur Reduzierung liegt im ausschließlichen Einsatz erneuerbarer Energien in der Zellfertigung.24 Optimierte Prozesse könnten den Ausstoß auf 20 Kilogramm
CO2eq/kWh senken.24
Der Weg zur Klimaneutralität: Der „Break-Even“-Punkt
Die anfänglich höheren Produktions-Emissionen eines BEV werden durch die deutlich geringeren Emissionen während der Nutzungsphase ausgeglichen. Der entscheidende Punkt ist, wann die CO₂-Bilanz des Elektroautos die eines Verbrenners überholt. Die Ergebnisse verschiedener Studien variieren, was auf unterschiedliche Annahmen zurückzuführen ist:
Studien des Umweltbundesministeriums und EnergieSchweiz: Kompensation nach 30.000 Kilometern oder 2-4 Jahren.5 Eine andere Quelle nennt 27.632 Kilometer oder 2 Jahre.3
Studie des VDI: Der Break-Even-Punkt wird ab 90.000 Kilometern Laufleistung erreicht.18
Studien des ADAC und P3: Die Amortisation der höheren Treibhausgasemissionen aus der Produktion erfolgt bei Nutzung von regenerativem Strom bereits nach 25.000 bis 30.000 Kilometern.5
Die Unterschiede in diesen Ergebnissen sind auf die verwendeten Annahmen zurückzuführen, insbesondere auf den zugrunde gelegten Strommix. Die Verwendung von Ökostrom verkürzt die Amortisationszeit drastisch 5, während ein hoher Anteil an Kohlestrom die Bilanz verschlechtert. Ebenso spielen die Größe des Fahrzeugs und die Batteriekapazität eine Rolle: Ein größerer BEV mit einer größeren Batterie hat einen höheren Rucksack und benötigt eine längere Amortisationszeit.18
Eine Studie des Ifo-Instituts, die behauptete, Dieselautos seien in bestimmten Szenarien klimafreundlicher als Elektroautos, wurde in nachfolgenden Analysen als irreführend entlarvt.4 Die Studie verwendete veraltete Verbrauchsdaten des NEFZ-Zyklus, rechnete mit einem unrealistisch hohen Kohlestromanteil und vernachlässigte die höheren realen Emissionen von Verbrennern.4 Diese kritische Auseinandersetzung unterstreicht die Notwendigkeit, alle Annahmen in der Klimabilanzierung genau zu prüfen.
Die CO₂-Emissionen über die gesamte Lebensdauer
Trotz des anfänglich höheren Rucksacks sind BEVs über ihre gesamte Lebensdauer hinweg die klimafreundlichste Option. Laut Studien sind die Gesamtemissionen eines Elektroautos nur etwa halb so hoch wie die eines konventionellen Autos.23 Die Bilanz des BEV ist dynamisch: Der anfängliche Rucksack wird nur einmal getragen, während die Emissionen in der Nutzungsphase kontinuierlich sinken, da der Strommix in Deutschland und der EU stetig sauberer wird.24 Dies steht im Gegensatz zum Verbrenner, dessen Emissionen pro Kilometer über die gesamte Lebensdauer konstant hoch bleiben und er somit ein "Emissionsriese" bleibt.27 Über eine Lebensdauer von 200.000 Kilometern verursacht ein Benziner 37 Tonnen CO2eq und ein Diesel 33 Tonnen CO2eq, während ein E-Auto nur 24,2 Tonnen CO2eq emittiert.18
Antriebsart | CO₂-Rucksack Produktion (t) | Gesamt-CO₂ über 200.000 km (t) | CO₂-Amortisationszeit (km) | Einflussfaktoren |
Verbrennungsmotor | bis zu 8 4 | 33 (Diesel), 37 (Benzin) 18 | Nicht zutreffend | Kraftstoffmix (fossiler vs. biogener Anteil) |
Batterieelektrisches Fahrzeug | bis zu 11 4 | 24,2 18 | 30.000-90.000 24 | Strommix (Ladung & Produktion), Batteriegröße, Fahrleistung 3 |
Perspektiven und zukünftige Einsatzgebiete
Die Rolle der Hybride
Hybride, insbesondere Plug-in-Hybride, dienen als Brückentechnologie auf dem Weg zur Elektromobilität. Sie bieten eine praktische Übergangslösung für Verbraucher, die über keine regelmäßige Lademöglichkeit verfügen oder häufig lange Strecken fahren.14 Ihre Fähigkeit, im Stadtverkehr elektrisch zu fahren und durch Bremsenergierückgewinnung die Effizienz zu steigern, ist ein klarer Vorteil.16 Dennoch sind sie keine langfristige Lösung für eine umfassende Dekarbonisierung des Verkehrs, da sie weiterhin auf fossile Brennstoffe angewiesen sind und lokale Emissionen verursachen.14
Wasserstoff und E-Fuels: Einsatz abseits des Pkw-Verkehrs
Die vorgestellte Analyse der Energieeffizienz legt nahe, dass Wasserstoff und E-Fuels im Pkw-Sektor aufgrund ihrer immensen Umwandlungsverluste ineffiziente Alternativen sind. Ihr hoher Energiebedarf und die damit verbundenen hohen Kosten machen sie für den Massenmarkt unrentabel.19 Ihre Stärken liegen jedoch in anderen Bereichen, in denen eine direkte Elektrifizierung technisch unpraktikabel oder unmöglich ist.
Wasserstoff (FCEV): Die schnelle Betankung in wenigen Minuten 28 und die hohe Energiedichte des Wasserstoffs machen ihn zu einer vielversprechenden Lösung für schwere Nutzfahrzeuge wie Lkw, Busse oder Züge. In diesen Anwendungsbereichen bieten FCEVs Vorteile gegenüber großen, schweren und zeitaufwendig zu ladenden Batterien.29
E-Fuels: Synthetische Kraftstoffe sind für Sektoren wie die Luft- und Schifffahrt unverzichtbar, da dort die Speicherung und Nutzung von elektrischer Energie in Batterien nicht möglich ist.31 Die begrenzten Produktionskapazitäten von E-Fuels sollten daher in erster Linie auf diese Anwendungsbereiche konzentriert werden.32
Zukunftsausblick
Der Ausbau erneuerbarer Energien ist der entscheidende Hebel, um die Klimabilanz aller alternativen Antriebe zu verbessern. Die Effizienz- und CO₂-Vorteile von BEVs wachsen kontinuierlich mit dem steigenden Anteil von Wind- und Solarenergie im Strommix.5 Eine Mobilitätswende, die ihre Klimaziele erreichen will, sollte sich nicht in einem Konkurrenzkampf zwischen Technologien verzetteln. Vielmehr ist eine strategische Allokation von Ressourcen und ein intelligenter Technologiemix notwendig. Die Datenlage zeigt, dass die Direktelektrifizierung die effizienteste Lösung für den Pkw-Sektor ist, während Wasserstoff und E-Fuels als komplementäre Lösungen für andere Bereiche eine wichtige Rolle spielen.30
Fazit und Empfehlungen
Zusammenfassende Bewertung
Die vorliegende Analyse auf Basis einer Well-to-Wheel- und Lebenszyklusanalyse kommt zu dem klaren Ergebnis, dass der batterieelektrische Antrieb (BEV) die effizienteste und langfristig klimafreundlichste Antriebsform im Pkw-Sektor ist. Mit einem Well-to-Wheel-Wirkungsgrad von 64 % ist er einem Verbrennungsmotor (20 %) und einem Brennstoffzellenfahrzeug (27 %) weit überlegen.6 Während der BEV in der Produktion anfänglich einen höheren CO₂-Rucksack hat, wird dieser Nachteil durch die erheblich geringeren Emissionen im Betrieb schnell ausgeglichen. Je nach den Annahmen amortisiert sich die CO₂-Bilanz bereits nach 2 bis 4 Jahren oder 30.000 bis 90.000 Kilometern.3
Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen
Priorisierung der Direktelektrifizierung: Der Ausbau der batterieelektrischen Mobilität sollte das primäre Ziel im Pkw-Sektor sein, da dies der ökonomisch und ökologisch effizienteste Weg zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist.
Gezielter Einsatz von Wasserstoff und E-Fuels: Anstatt als direkte Konkurrenz zu BEVs sollten diese Technologien als komplementäre Lösungen für spezifische Anwendungsbereiche gefördert werden, in denen die Direktelektrifizierung nicht praktikabel ist. Dazu gehören der Schwerlastverkehr, die Luftfahrt und die Schifffahrt.
Beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien: Die Effizienz und CO₂-Bilanz aller alternativen Antriebe sind direkt vom Strommix abhängig. Der beschleunigte Ausbau von Wind- und Solarenergie ist daher der zentrale Hebel, um die Nachhaltigkeit der Mobilität zu gewährleisten und die Klimabilanz der Elektromobilität kontinuierlich zu verbessern.
Ausblick: Die Zukunft der Mobilität
Die Mobilitätswende erfordert ein Umdenken, weg von einer Einheitslösung hin zu einem intelligenten Mix aus Technologien, die jeweils dort eingesetzt werden, wo sie ihre Stärken ausspielen. Die bereitgestellten Daten zeigen, dass dies ein realistischer und notwendiger Weg ist, um die Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen.
Referenzen
TVETipedia Glossary - UNESCO-UNEVOC, Zugriff am September 19, 2025, https://unevoc.unesco.org/home/+TVETipedia+Glossary/lang=en/show=term/term=Well+to+wheel
Sustainability Terminology - LEMAN, Zugriff am September 19, 2025, https://leman.com/sustainability-terminology/
CO₂-Bilanz | Elektromobilität.NRW, Zugriff am September 19, 2025, https://www.elektromobilitaet.nrw/infos/co2-bilanz/
CO2-Fussabdruck Produktion eines Autos - carbon-connect, Zugriff am September 19, 2025, https://www.carbon-connect.ch/resources/co2-fussabdruck/neues-auto
Treibhausgas-Bilanz: Welcher Antrieb kann das Klima retten? - ADAC, Zugriff am September 19, 2025, https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/alternative-antriebe/klimabilanz/
Effizienz und Kosten: Lohnt sich der Betrieb eines Elektroautos?, Zugriff am September 19, 2025, https://www.bundesumweltministerium.de/themen/verkehr/elektromobilitaet/effizienz-und-kosten
Wirkungsgrad: Elektroautos liegen weit vorn | Infografik - BMUKN, Zugriff am September 19, 2025, https://www.bundesumweltministerium.de/media/wirkungsgrad-elektroautos-liegen-weit-vorn
Auto-Motor: Der Verbrenner ist kein Auslaufmodell - DER SPIEGEL, Zugriff am September 19, 2025, https://www.spiegel.de/spiegelwissen/auto-motor-der-verbrenner-ist-kein-auslaufmodell-a-999738.html
Weniger Energieverbrauch in der Industrie beginnt beim Motor - Eriks, Zugriff am September 19, 2025, https://eriks.de/de/know-how-hub/blog/weniger-energieverbrauch-in-der-industrie-beginnt-beim-motor/
Das Elektroauto bietet die meisten Vorteile - Das Parlament, Zugriff am September 19, 2025, https://www.das-parlament.de/wirtschaft/verkehr/das-elektoauto-bietet-die-meisten-vorteile
Wasserstoff Brennstoffzelle - TÜV Nord, Zugriff am September 19, 2025, https://www.tuev-nord.de/de/dienstleistungen/pruefung-und-gutachten/wasserstoff/wasserstoff-brennstoffzelle/
www.tuev-nord.de, Zugriff am September 19, 2025, https://www.tuev-nord.de/de/dienstleistungen/pruefung-und-gutachten/wasserstoff/wasserstoff-brennstoffzelle/#:~:text=Aktuell%20betr%C3%A4gt%20der%20Wirkungsgrad%20einer,Wirkungsgrad%20von%2060%20bis%2070%20%25.
Grüner Wasserstoff: Neue Danfoss-Studie fordert effiziente Produktion und Nutzung, Zugriff am September 19, 2025, https://www.danfoss.com/de-de/about-danfoss/news/cf/green-hydrogen-new-danfoss-study-calls-for-efficient-production-and-use/
Hybrid oder Elektro? Vergleich für den Alltag | Toyota AT, Zugriff am September 19, 2025, https://www.toyota.at/elektromobilitat/magazin/hybrid-oder-elektro
Grafik: Wirkungsgrade bei Motoren - E-Motoren am effizientesten - MotorZeitung.de, Zugriff am September 19, 2025, https://motorzeitung.de/news.php?newsid=6556661
Plug-In-Hybride: Studie zeigt katastrophale Verbrauchs-Bilanz - FOCUS online, Zugriff am September 19, 2025, https://www.focus.de/auto/ratgeber/kosten/icct-untersucht-plug-in-hybride-neue-studie-zeigt-katastrophale-verbrauchs-bilanz-von-hybridfahrzeugen_id_107951616.html
FVV steigert Wirkungsgrad in Hybridfahrzeug auf 42 Prozent | springerprofessional.de, Zugriff am September 19, 2025, https://www.springerprofessional.de/ottomotor/hybridtechnik/fvv-steigert-wirkungsgrad-in-hybridfahrzeug-auf-42-prozent/18683476
VDI-Ökobilanz zu PKW mit verschiedenen Antriebssystemen, Zugriff am September 19, 2025, https://www.vdi.de/themen/mobilitaet/vdi-oekobilanz-fuer-pkw-antriebe
E-Fuels im Vergleich: Energieaufwand, Kosten und Nachhaltigkeit - emobicon, Zugriff am September 19, 2025, https://emobicon.de/e-fuels-vergleich-energieaufwand-kosten-nachhaltigkeit/
Häufig gestellte Fragen zu Wasserstoff | Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B), Zugriff am September 19, 2025, https://h2.bayern/infothek/faqs/
E-Fuels Kraftstoff - StromSpeicherMarkt.de, Zugriff am September 19, 2025, https://stromspeichermarkt.de/e-fuels-kraftstoff/
E-Fuels oder Wasserstoff – bessere Alternativen zum E-Auto? - YouTube, Zugriff am September 19, 2025, https://www.youtube.com/watch?v=7r8reBsadyk
Elektroautos und Umwelt - EnergieSchweiz, Zugriff am September 19, 2025, https://www.energieschweiz.ch/programme/fahr-mit-dem-strom/umwelt/
CO2-Rucksack: So werden E-Auto-Batterien nachhaltiger - Elektroauto-News, Zugriff am September 19, 2025, https://www.elektroauto-news.net/news/co2-rucksack-batterien-p3-studie
CO2-Bilanzen von Verbrennern und Elektroautos nicht eindeutig | springerprofessional.de, Zugriff am September 19, 2025, https://www.springerprofessional.de/emissionen/antriebsstrang/co2-bilanzen-von-verbrennern-und-elektroautos-nicht-eindeutig/26882824
Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2-Bilanz? - ifo Institut, Zugriff am September 19, 2025, https://www.ifo.de/DocDL/sd-2019-08-sinn-karl-buchal-motoren-2019-04-25.pdf
ICCT: Elektroautos deutlich grüner als Verbrenner - Edison - Heimat der Generation E, Zugriff am September 19, 2025, https://edison.media/umwelt/icct-elektroautos-deutlich-gruener-als-verbrenner/25259324/
Was sind die Vor- und Nachteile von Wasserstoff-Brennstoffzellen? - TWI Global, Zugriff am September 19, 2025, https://www.twi-global.com/locations/deutschland/was-wir-tun/haeufig-gestellte-fragen/was-sind-die-vor-und-nachteile-von-wasserstoff-brennstoffzellen
Wasserstoff im Verkehr: Häufig gestellte Fragen (FAQs) - Umweltbundesamt, Zugriff am September 19, 2025, https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr/kraftstoffe-antriebe/wasserstoff-im-verkehr-haeufig-gestellte-fragen
Sieben gute Gründe für Wasserstoffantrieb und Brennstoffzelle - developmentscout, Zugriff am September 19, 2025, https://www.developmentscout.com/branche/automobil/11644-wasserstoffantrieb-brennstoffzelle-bosch
Kraftstoffe und Antriebe - Umweltbundesamt, Zugriff am September 19, 2025, https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr/kraftstoffe-antriebe
E-Fuel-Produktion auf Flug- und Schiffsverkehr konzentrieren - Agora Verkehrswende, Zugriff am September 19, 2025, https://www.agora-verkehrswende.de/aktuelles/e-fuel-produktion-auf-flug-und-schiffsverkehr-konzentrieren

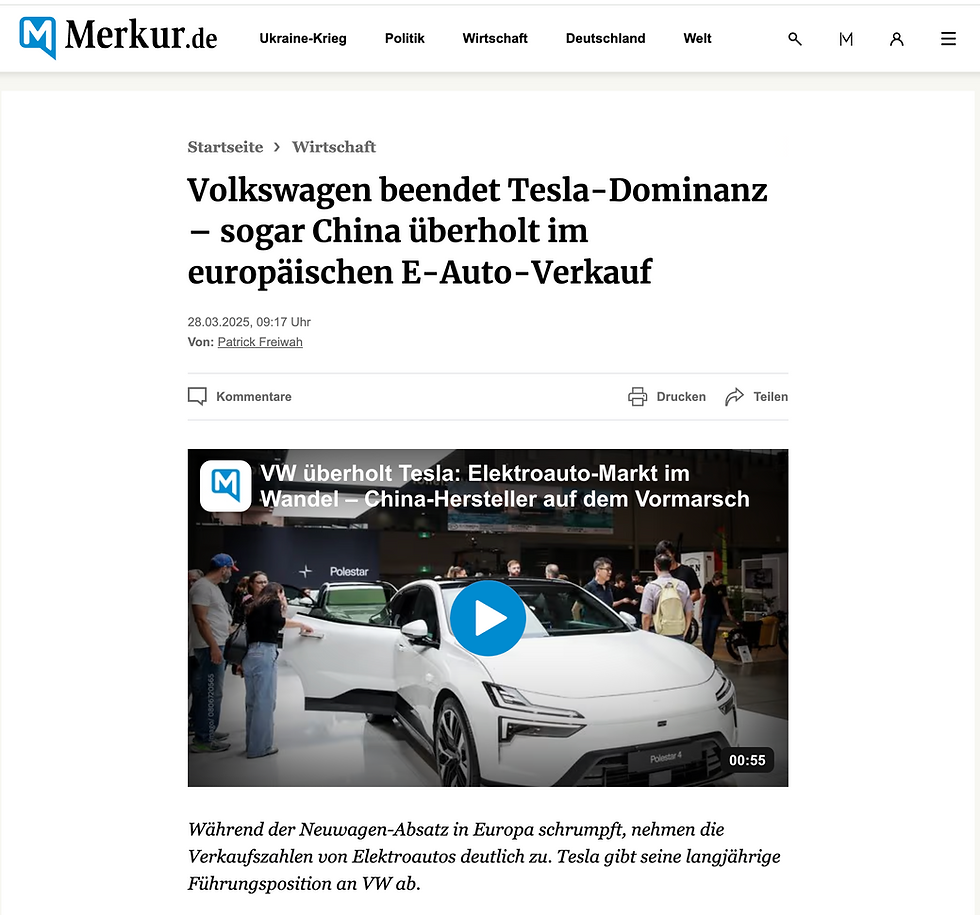

Kommentare